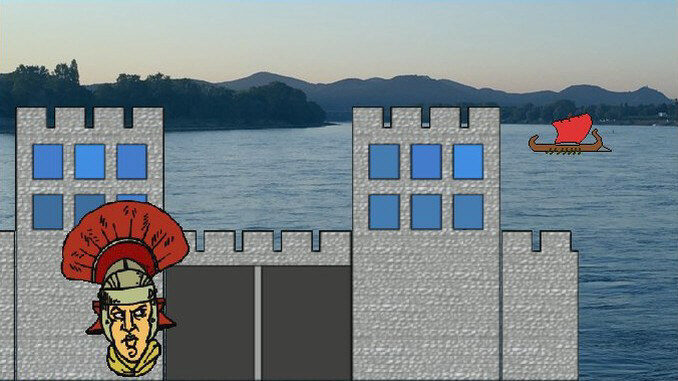
Im Mittelpunkt des zweiten Beitrags steht die „Bonner“ Legion I Minervia. Nach dem Bataver-Aufstand bezog sie das große Legionslager im Bonner Norden, erbaut mit Steinen vom Drachenfels.
Legion I Minervia
Im Jahr 83 kam die von Kaiser Domitian (79-96) neu rekrutierte Legion I Minervia nach Bonn. Der Kaiser selbst hatte sie für seinen Feldzug gegen die Chatten ausgehoben und sie „legio I Minervia Flavia Domitiana“ benannt. Flavia nach ihm, denn Domitian war der letzte Kaiser der flavischen Dynastie, und Minerva war seine Lieblingsgöttin.
Nun stand sie in dem gewaltigen neuen Legionslager Bonn, erbaut mit Steinen vom Drachenfels. Die Legion XXI Rapax war zurück nach Mainz gegangen. Die meisten die Legionäre stammten aus Südgallien und waren zuvor noch nicht am Rhein gewesen. Noch immer bot die Armee jungen Männern Chancen und ein regelmäßiges, gutes Einkommen, freilich mussten sie mobil sein. Nach der ehrenvollen Entlassung bekamen die Veteranen etwas Land geschenkt.
Römische Provinzen und der Limes
Noch zur Regierungszeit Vespasians hatten die Römer das Dekumatland erobert, dadurch war die Grenze kürzer geworden. Nun ließ Domitian zur Sicherung der Provinzen Germania Superior und Rätien eine befestigte Grenzanlage bauen, den Obergermanisch-Rätischen Limes. Von Rheinbrohl im heutigen Rheinland-Pfalz bis nach Eining in Bayern nahe dem späteren Legionslager Castra Regina entstanden Grenzbefestigungen.
Domitian, der anders als sein Vater Vespasian und sein Bruder Titus noch keinen militärischen Ruhm erlangt hatte, zog im Jahr 85 mit einem gewaltigen Heer über den Rhein und besiegte die germanischen Chatten. Danach wandelte er die bisherigen Militärbezirke in römische Provinzen um: Germania Superior mit der Hauptstadt Mogontiacum, das heutige Mainz, und Germania Inferior mit der Hauptstadt C.C.A.A, das heutige Köln.
Im Jahr 89 kam es zum Saturninus-Aufstand gegen den Kaiser, unterstützt von den Chatten und den Mainzer Legionen XIIII Gemina und XXI Rapax. Das niedergermanische Heer, (I Minervia, VI Victrix, X Gemina, XXII Primigenia) schlug ihn nieder.
Reorganisation an der Rheingrenze
Unter Kaiser Trajan (98-117) erreichte das Römische Reich seine größte Ausdehnung. Die Legion I Minervia zog mit ihm nach Dakien und blieb nach dem ersten Dakerkrieg als Besatzungstruppe vor Ort; im zweiten kämpfte sie unter dem späteren Kaiser Hadrian. Erst 107 kehrte sie an den Rhein zurück.
Trajan ließ die Grenzbefestigungen verstärken, dafür wurden die Legionsstandorte Nimwegen und Neuss aufgegeben. Sein Nachfolger Hadrian (117-138) setzte auf die Sicherung der Grenzen. Er besuchte auch Germania Inferior und ordnete die Verstärkung des niederrheinischen Limes an. Nach Xanten kam die Legion XXX Ulpia Victrix, und seitdem bildete sie mit der Bonner Legion I Minervia das Niedergermanische Heer (Exercitus Germaniae Inferioris).
Die Zeit von Kaiser Antoninus Pius (138-161) war eine Zeit relativen Friedens, doch es kam zu Aufständen. Eine Vexillation der I Minervia kämpfte bei der Niederschlagung eines Maurenaufstandes in Nordafrika.
Bonna – ein schmuckes Städtchen am Rhein
Bonn lag an der römischen Rheintalstraße, die am Rhein entlang von der CCAA über Bonn nach Koblenz und weiter nach Germania Superior führte. Das Städtchen blühte auf und bot bald allen Komfort. Im Zentrum gab es einen großen öffentlichen Platz, dazu Badegebäude, Tempel und sogar ein großes öffentliches Bad. Entlang der Rheintalstraße und ihrer Nebenstraßen lagen die römischen Häuser. Zumeist waren es lange, schmale Streifenhäuser mit Steinsockel und Wänden in Fachwerkbau. Viele Häuser hatten zur Straße hin kleine Verkaufsläden oder Werkstätten, dahinter lagen die Wohnräume.
Die Legion I Minervia im Osten
Die Zeit Kaiser Marc Aurels (161-180) war ein Wendepunkt, denn das Römische Reich wurde in die Defensive gedrängt.
Als im Osten des Reiches die Parther das römische Armenien angriffen, gab es Krieg (162-166). Auch die Legion I Minervia war dabei, sie kämpfte unter Marcus Claudius Fronto in Armenien und im Kaukasus und kam bis zum Kaspischen Meer. Eine andere römische Armee unter Avidius Cassius drang weit ins Partherreich vor, eroberte die Metropolen Ktesiphon und Seleukia, zerstörten den Königspalast und machten nicht einmal vor Tempeln halt.
Doch beim Brandschatzen und Plündern infizierten sich die römischen Soldaten, und bald darauf brach eine verheerende Seuche aus. Entlang der Rückwege der Soldaten und der Handelsrouten verbreitete sie sich weiter an den Rhein und bis hinauf nach Britannien. In vielen Regionen starben unzählige Menschen einfach weg.
In Bonn wurden den Aufanischen Müttern Weihesteine gewidmet als Dank für das Überleben und die Heimkehr der Soldaten. Mit den Legionen kamen Personen griechischer und syrischer Herkunft an den Rhein.
Neue Feinde
Immer mehr Germanenstämme drangen aus dem Inneren Germaniens an die Grenze des Reiches vor. Die Markomannen und Quaden überschritten die Donau. Noch immer tobte die Seuche und der Kaiser hatte kaum Soldaten, um die langgestreckte Donaugrenze zu verteidigen. Auch die Legion I Minervia, oder wenigstens Abordnungen, kämpften mit. Dennoch konnte er in zwei erbitterten Kriegen die Donaugrenze sichern, doch die Reserven waren erschöpft und das Reich geriet in eine tiefe Wirtschaftskrise. Ganze Regionen waren menschenleer; hier siedelte der Kaiser Germanen an, damit sie das Land bestellten und zur Not verteidigten. Er selbst erkrankte an der Pest und starb in Wien. Sein Nachfolger Commodus (180-192) schloss einen Waffenstillstand mit den Markomannen.
Im Bürgerkrieg nach Commodus‘ Tod (196/97) schlug sich die Legion I Minervia in Bonn sofort auf die Seite von Septimius Severus. Nach dessen Sieg wurde eine Vexillation in der gallischen Hauptstadt Lyon stationiert. Eine Vexillation der vier germanischen Legionen kämpfte im zweiten Partherkrieg 197/198 mit Kaiser Septimius Severus.
Römische Bürger
Im Römischen Reich regierte die Dynastie der Severer (193-235), und auch die Bonner verehrten das severische Kaiserhaus. Die Zeit der Severer brachte zunächst noch einmal eine Stabilisierung an den Grenzen. Mit der Constitutio Antoniniana 212 verlieh Kaiser Caracalla allen Freien in den Provinzen das römische Bürgerrecht. Auch die Bonner waren jetzt römische Bürger.
Fremde Elbgermanen auf der rechten Rheinseite
Doch im Südwesten, den „Agri Decumates“ zwischen Rhein und Donau, war eine neue große Germanengruppe aufgetaucht, die Alemannen. Kaiser Caracalla entschloss sich 213 zu einem Präventivschlag und führte selbst seine Truppen an.
Truppenabzug vom Rhein
Als die Sassaniden 226 die Sassaniden die Macht übernahmen, sahen sich die Römer einem noch gefährlicheren Feind gegenüber. Kaiser Alexander Severus, der aus Syrien stammte, zog mit seinem Heer in den Orient (230-233). Nachdem er dafür Truppen vom Rhein abgezogen hatte, war die Rheingrenze nicht gesichert. Es kam Raubzügen feindlicher Germanen, doch 231 konnte die Legion I Minervia auf der Beueler Rheinseite germanische Plünderer besiegen. Auf dem Schlachtfeld errichtete sie einen Siegesaltar.
233/234 drangen die Alemannen über den Limes, brannten Kastelle nieder und fielen in Germania Superior und Raetien ein. Die Landgüter der Römer wurden überfallen, die Menschen erschlagen oder versklavt, das Landgut geplündert und angezündet. Viele Menschen vergruben ihren Besitz (Hortfunde).
Daraufhin bracht Kaiser Severus Alexander den Feldzug gegen die Sassaniden ab und eilte an den Rhein nach Mainz. Als er den Feinden hohe Summen bot, anstatt gegen sie zu kämpfen, wurden seine Mutter und er von aufgebrachten Truppen um Maximinus Thrax ermordet (235). Der wurde zum Kaiser ausgerufen, auch die Legion I Minervia unterstützte ihn. Mit ihm beginnt die Zeit der „Soldatenkaiser“.
Legion I Minervia am Harzhorn
Es war eine Zeit der Krisen. Im Inneren ließ der ständige, oft gewaltsam herbeigeführte Wechsel auf dem Kaiserthron das Reich nicht zur Ruhe kommen. Nach außen musste es sich an mehreren Fronten gegen neue, mächtige Feinde verteidigen: die Sassaniden im Osten, die Goten an der Donau, die germanischen Großverbände an der Rheingrenze. Eine koordinierte Abwehr war kaum mehr möglich.
Kaiser Maximinus Thrax (235-238) brach mit seinen Legionen zu einem Vergeltungsfeldzug ins Innere Germaniens auf. Panzerreiter und Bogenschützen verstärkten sein Heer, auch die Bonner Legion I Minervia war mit dabei. Auf dem Rückmarsch gerieten die Römer am Harzhorn in Germanien in einen Hinterhalt der Germanen, doch dank ihrer überlegenen Ausrüstung und Waffentechnik siegten sie.
Maximinus Thrax führte seine ganze Regierungszeit durch Krieg und wurde am Ende von Soldaten ermordet.
Auch in Germania Inferior kam es zunehmend zu Überfällen rechtsrheinischer Germanen. Noch konnte die Armee die römischen Landgüter und Höfe gut verteidigen, doch die Überfälle wurden immer mehr und erfolgten in immer kürzeren Abständen. Oft genug kam die römischen Truppen zu spät. Das rief andere Kriegsherrn auf den Plan, und in den 240er Jahren brach die Verteidigungslinie entlang des Niederrheins in Holland zeitweise zusammen.
Frühzeit und Römerzeit
Frühzeit | Germania Inferior | Bonner Legion I Minervia | Franken und Alamannen | Spätantike

Hinterlasse jetzt einen Kommentar