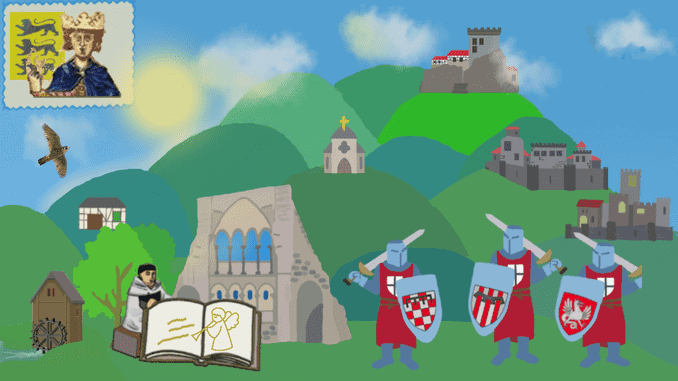
Die Herren vom Siebengebirge, das sind vor allem die Burggrafen vom Drachenfels und von der Wolkenburg sowie zahlreiche Herren auf der Löwenburg. Dann haben wir kurz den Herrn von der Rosenau.
Aus der Zeit der Burgen gibt es eine Menge zu berichten. In den Kapiteln zum Hoch– und Spätmittelalter geht es um Könige, Feldzüge, Fehden und überhaupt um Ereignisse, welche die Herren vom Siebengebirge auch betrafen. Hier im Kapitel Burgruinen „zoomen“ wir näher heran, das heißt wir konzentrieren uns sie. Wie haben die Herren vom Siebengebirge das alles erlebt?
Kölner Burgen
Die Grafen vom Siebengebirge lebten im Umfeld der Kölner Erzbischöfe, die damals mächtige Herren in Reich und Region waren. Das Städtchen Königswinter mit den Burgen Drachenfels und Wolkenburg sowie Ittenbach gehörten stets zum Kölner Territorium; die umliegenden Orte gehörten zu anderen Herrschaften. Im Siebengebirge stießen die Interessen der regionalen Mächte aufeinander – die der Kölner Erzbischöfe mit ihren Burgen Drachenfels und Wolkenburg, der Grafen von Sayn mit ihrer Burg Blankenberg an der Sieg und der Löwenburg, und im Spätmittelalter die der Grafen von Berg.
Eins vorab: Ein mittelalterlicher Erzbischof war nicht nur ein geistiger Würdenträger, sondern auch eine politisch wichtige Figur. Der Kölner allein hatte das Recht, die Könige des Reiches in Aachen zu krönen. Erzbischof Rainald von Dassel (1159-1167) war Friedrich Barbarossas Reichskanzler.
Burg Wolkenburg
Als erste Burg im Siebengebirge entstand vor 1118 Burg Wolkenburg. Damals tobte ein Machtkampf zwischen den Saliern Heinrich IV. und seinem Sohn Heinrich V., in den auch der Kölner Erzbischof Friedrich I. von Schwarzenburg (1100-1131) verwickelt wurde. Er wechselte mehrfach die Fronten und zog schließlich als Anführer einer niederrheinischen Opposition gegen Heinrich V. in die Schlacht.
Es waren unruhigen Zeiten. Zur Sicherung der Südgrenze seines Gebiets errichtete der Erzbischof die Burgen Wolkenburg (vor 1118) und Rolandseck (1127-1131). Leider ist von der Burg Wolkenburg nichts erhalten geblieben, nur eine Skizze, die uns ihr Aussehen erahnen lässt. Wir wissen, dass Rudolf, ein Sohn eines Burggrafen aus Kerpen, 1125 das Amt des Burggrafen übernahm, es an seine Söhne weitergab und so das Haus Wolkenburg begründete.
Burg Drachenfels
Die Grafen von Sayn und die Grafen von Berg machten dem Erzbistum die Vorherrschaft in unserer Region zunehmend streitig. Daher begann begann Erzbischof Arnold I. von Merxheim (1137-1151) um 1140 mit dem Bau einer Burg auf dem Drachenfels. Doch seine Männer plünderten in den Dörfern der Umgebung, zerstörten Felder und Weinberge. Besonders schlimm traf es das Bonner St. Cassius-Stift unter Propst Gerhard von Are.
Der war nicht irgendwer. Er selbst war hochadliger Herkunft, der Stift war damals die wichtigste Propstei des Kölner Erzbistums, und der Propst der zweitmächtigste Mann nach dem Erzbischof. Unter Gerhard von Are wurde das Bonner Münster ausgebaut, auch der Kreuzgang entstand damals.
Nun bat Propst Gerhard von Are den Erzbischof immer wieder dringend, ihm die Burg zu übertragen. Doch erst als der umstrittene Erzbischof selbst in arge Bedrängnis geriet, lenkte er ein. Unter Propst Gerhard von Are wurde Burg Drachenfels fertig gebaut, 1167 stand Burg Drachenfels.
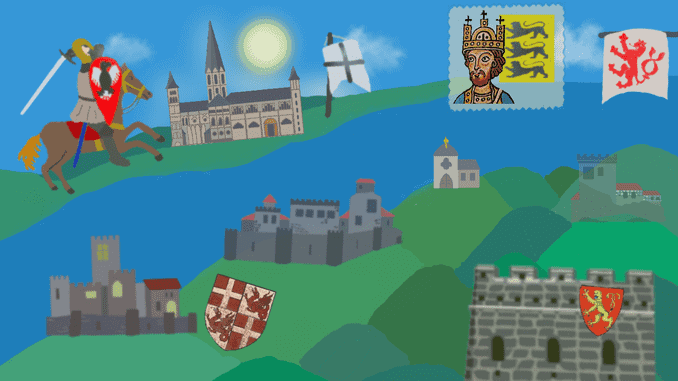
Der Verwaltung der Burg oblag zunächst Dienstleuten, Ministerialen. Wir wissen von einem ersten Godart, Sohn des Wolkenburger Burggrafen, der 1176 das Haus Drachenfels begründete.
Die Grafen von Sayn
Im Bonner Raum und an der Sieg hatten die Grafen von Sayn viel Einfluss gewonnen. Graf Heinrich II. hatte in eine bedeutende Familie am Niederrhein geheiratet und bekam wichtige Bonner Vogteien übertragen, sogar Kölner Domvogt wurde er. Oberhalb der Sieg entstand ihre Burg Blankenberg. Noch war keine Rede von der Burg auf der Löwenburg, doch mit der Heirat kam auch das Löwenburger Land an die Familie.
Die Grafen von Berg
Die Berger waren eine mächtige Familie im Norden unserer Region. Schon zweimal hatten sie die Erzbischöfe gestellt und strebten auch weiter dieses Amt an. Mit Burg Windeck als Lehen konnten sie an der mittleren Sieg Fuß fassen. Als Siegburger Vögte unterstand ihnen auch die Siegburger Propstei in Oberpleis.
Die Grafen im Reichsdienst
Wenn man von den „Herren im Siebengebirge“ spricht, mag an ein beschauliches Leben am Rhein denken, doch so war es nicht. Beide Grafenhäuser, die Sayner und die Berger, standen im Reichsdienst Kaiser Friedrich Barbarossas und zogen mit ihm nach Italien und zuletzt ins Heilige Land. Graf Engelbert von Berg kam dabei um, Graf Heinrich II. von Sayn kehrte zurück.
Als Kölner Lehnsleute folgten die Grafen von Sayn Erzbischof Philipp von Heinsberg (1167-1191) bei seinen Feldzügen gegen Heinrich den Löwen. Einige Jahre später standen sie ihm bei seiner Machtprobe mit dem Kaiser zur Seite.
Wahrscheinlich waren die Grafen von Sayn auch im Februar 1194 zu den „glänzenden Feierlichkeiten“ nach Köln geladen, zu Ehren von König Richard I. Löwenherz und seiner Mutter Alienor von Aquitanien. Lange hatte Barbarossas Sohn und Nachfolger Heinrich VI. Richard Löwenherz gefangen gehalten und erst gegen ein gewaltiges Lösegeld freigelassen.
Otto IV. und die Grafen von Sayn
Die nächsten Jahrzehnte wurden vom Thronstreit zwischen dem Staufer Philipp von Schwaben, Heinrichs jüngerem Bruder, und Otto von Braunschweig überschattet. Otto war der dritte Sohn Heinrichs des Löwen und Lieblingsneffe von Richard Löwenherz, der hatte ihn auch beim Kölner Erzbischof ins Spiel gebracht.
Fehde
Die Grafen von Sayn standen von Anfang an entschieden auf der Seite Ottos. Doch die nächsten Jahre wurden sehr hart für die Familie. Graf Heinrich II. und Eberhard II. gerieten in eine fürchterliche Fehde mit Dietrich von Landsberg, der den an saynisches Gebiet angrenzenden thüringischen Besitz hielt und ein Anhänger der Staufer war. Sie wurden gefangen genommen und starben wenig später.
Erst Jahre später sollte die Ehe zwischen dem jungen Grafen Heinrich III. und Dietrichs Tochter Mechthild, vermittelt durch die Abtei Heisterbach und Papst Innozenz III., die Fehde beenden.
Bruno von Sayn
Bruno von Sayn hatte Ottos Sache bei Papst Innozenz III. in Rom vertreten und wurde 1205 Kölner Erzbischof. Mitte Otto verteidigte er Köln, zog in die Schlacht, wurde gefangen genommen und lange eingekerkert. Der junge Graf Heinrich III. wurde ein entschiedener Streiter für seinen Onkel und Otto IV. Als Ottos Sache schon verloren schien, wurde Philipp von Schwaben in Bamberg ermordet. Endlich wurde Bruno freigelassen, doch seine Gegner im Erzbistum wichen nicht. Gezeichnet von der langen Gefangenschaft, musste er noch einmal nach Rom zum Papst. Bald darauf, im November 1208, verstarb er auf Burg Blankenberg.
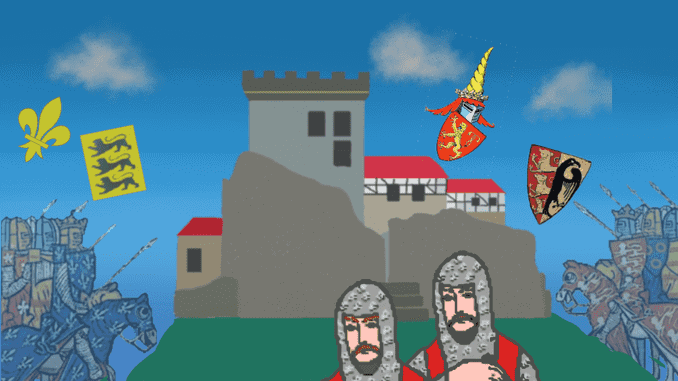
Burg Löwenburg
Vermutlich in jenen Jahren entstand die Burg auf der Löwenburg, vielleicht auch schon etwas früher. Anders als beim Drachenfels haben wir aber keine Daten, was genau damals passiert ist. Das verwundert nicht, denn es waren Kriegsjahre, und auch das Rheinland wurde verheert.
Die Niederlage
Auf Ottos kurze unumschränkte Herrschaft folgte schon 1212 ein Krieg gegen Friedrich II. und den mit ihm verbündeten französischen König.Nach Ottos Niederlage in Bouvines 1214 war der Weg im Reich frei für Friedrich. Ein Jahr später 1215 zogen seine Truppen den Rhein hinab Richtung Köln.
Man wird sie von der Löwenburg aus gesehen haben, und für Graf Heinrich bedeutete das eine große Gefahr, denn auch seine unmittelbaren Nachbarn, der Kölner Erzbischof und der Graf von Berg, standen längst im staufischen Lager. Er musste den Ausgleich suchen. Bei Friedrichs Aachener Krönung am 25. Juli 1215 war auch er unten den rheinischen Granden, alles andere hätte wohl unabsehbare Folgen gehabt.
Die Burggrafen vom Drachenfels
Um 1200 übertrug das Bonner St. Cassius-Stift Burg Drachenfels ihren Ministerialen zu Lehen, gegen einen Anteil der Einkünfte. Nun sind sie Burgherren und Lehnsleute der Bonner St. Cassius-Stifts am Kölner Lehnshof.Um 1225 ist als erster Burggraf Heinrich vom Drachenfels verzeichnet. Anders als etwa ein Landgraf gehören sie dem niederen Adel an.
Graf Heinrich III. von Sayn, ein mächtiger Regionalfürst
Um 1215 hatte Graf Heinrich III. Mechthild von Landsberg geheiratet. Sie war mütterlicherseits eine Enkelin des Thüringer Landgrafen und brachte den umfangreichen Besitz der Thüringer Landgrafen im Westerwald in die Ehe. Für den Grafen bedeutet es auch den Aufstieg in den Hochadel.
Bald darauf nahm der Graf am Kreuzzug nach Damiette 1218 teil und war 1220 zurück. In Berg trauerte man um Graf Adolf, der am 7. August 1218 an einer Seuche gestorben war.
Mit Mechthild zusammen stiftete er zahlreiche Klöster, und beide waren der Abtei Heisterbach sehr verbunden. Ihre Hauptsitze waren Burg Blankenberg, die Stammburg Sayn und der Sayner Hof in Köln. Die Quellen schweigen, was auf der Löwenburg derweil passierte. Wir wissen, dass weiter saynische Burgmannen dort waren.
Bald war Graf Heinrich III. ein mächtiger Fürst; auf wichtigen Reichstagen Friedrichs II. ist er bezeugt. Beim Ausbau seiner Landesherrschaft ist es sicher nicht immer friedlich zugegangen. Das verwundert nicht, wo doch sogar der Kölner Erzbischof Engelbert von Berg „mit eiserner Faust“ regierte und schließlich seine Machtgier mit dem Leben bezahlte. Sein Nachfolger war ein Verwandter Graf Heinrichs.
Graf Heinrichs herausgehobene Stellung hat ihn vielleicht gerettet, als der fanatische Inquisitor Konrad von Marburg, ehemaliger Beichtvater der Landgräfin Elisabeth von Thüringen, ihn 1233 der Ketzerei anklagte, was damals einem Todesurteil gleichkam. Ein Grund für den tödlichen Hass war vielleicht die Freundschaft zwischen Elisabeth und dem Sayner Grafenpaar. Mechthild und Elisabeth kannten sich von ihrer Kindheit am Thüringer Hof, und Elisabeth wird ihre Verwandten in Sayn mehrfach besucht haben.
Hochstaden
Dann wurde der skrupellose und gewaltbereite Konrad von Hochstaden (1238-1261) Kölner Erzbischof – ein Mann des Papstes, der den Stauferkaiser Friedrich II. unbedingt weg haben wollte. Eigeninteressen des Erzbischofs und politische Gegnerschaft vermischten sich. Es kam zu einer heftigen Fehde am Niederrhein, in die auch Graf Heinrich III. von Sayn verwickelt war und wohl eine Niederlage erlitt. Hinzu kam, dass der Erzbischof seine Schwester 1240 mit dem künftigen Grafen Adolf IV. von Berg verheirate, der sich ihm dann auch politisch anschloss.
Für den Grafen von Sayn muss die Lage schwierig geworden sein. In seinen letzten Lebensjahren brachte sich der Graf immer wieder ein, um den Frieden im Rheinland zu wahren.
Blankenberg
Burg Blankenberg war das Zentrum seiner Herrschaft, und 1245 gründeten Mechthild und er hier die Stadt Blankenburg. Hier verstarb er auch in er Silvesternacht 1246/47, ohne Erben.
Mechthild von Sayn erbt die Löwenburg
Nach dem Tod des Grafen zerfiel die große Grafschaft, die Machtstellung ging verloren. Für seine Witwe Mechthild, die Thüringerin, wurde schwer. In seinem Testament hatte der Graf seiner Gattin ihr u.a. die Burg Löwenburg als Witwensitz übertragen, doch bedrängt von den Verwandten ihres Mannes, übertrug sie in einer vorgezogenen Erbauseinandersetzung 1248 in Blankenberg u.a. auch Anteile der Löwenburg an Heinrich von Sponheim, den Gatten Sohn ihrer Schwägerin. Als sie sich schließlich für eine andere Burg als Witwensitz entschied, gab sie ihre Rechte an der Löwenburg ganz auf.
Mechthild lebte noch lange, aller Bedrängnis zum Trotz war sie die „große Gräfin“, die das Wohl der Menschen in ihrem Territorium am Herzen lag. Hingegen konnten die neuen Herren auf der Löwenburg die einstige Machtposition Graf Heinrichs III. nicht halten; die große Grafschaft zerfiel.
Rosenau
Seit 1222 nannte sich Dietrich von Dorndorf, ein niederer Adliger, Dietrich von Rosenouwe, also Herr der Burg Rosenouwe, das ist die mittelalterliche Schreibweise. Die Rosenau war eine kleine Burg unterhalb des Ölbergs, die sicher nicht komfortabel war. Wir wissen kaum etwas von ihr. Was wollte nun dieser Dietrich hier, und wessen Lehnsmann war er? Darüber können wir nur Vermutungen anstellen. Es ist gut möglich, dass er ein Kölner Lehnsmann war, der ein Auge auf die saynische Burg Löwenburg haben sollte. Er starb 1243, und noch im gleichen Jahr verkaufte seine Familie die Burg an das nahe gelegene Kloster Heisterbach. Vermutlich um 1250 wurde sie abgerissen.

Hinterlasse jetzt einen Kommentar