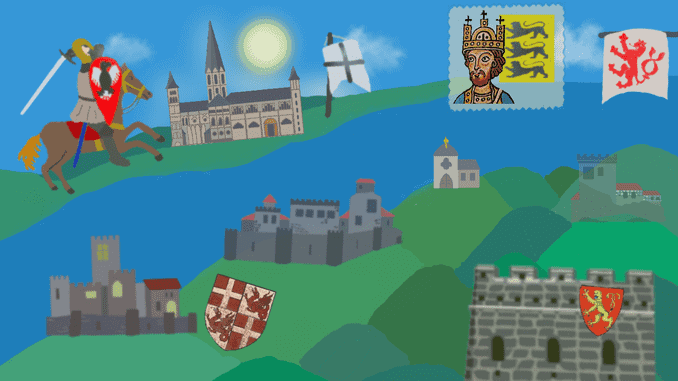
Der Beitrag „Barbarossa und die Kölner Erzbischöfe“ führt in die Zeit Friedrichs I. Barbarossa. Die Kölner Erzbischöfe waren mächtige Männer im Reich, sie krönten den König in Aachen. Barbarossas Kanzler, der Kölner Erzbischof Rainald von Dassel, war ihm eine wichtigste Stütze.
Heiliges Römisches Reich, um 1140. Seit zwei Jahren regiert König Konrad III. als erster Staufer auf dem Thron.
Konrad III.
Doch er ist nicht unumstritten. Neben den Staufern gehörten die Welfen zu den ersten Familien des Reiches. Bei der Wahl Konrads hatten sich die Welfen übergangen gefühlt, seither schwelte ein Konflikt.
Damals im Siebengebirge
Auch in unserer Region hatten die Kölner Erzbischöfe das Sagen. Seit 1118 stand ihre Burg auf dem Berg Wolkenburg; es war die erste Burg im Siebengebirge. Doch die Grafen von Sayn und die Grafen von Berg machten dem Erzbistum die Vorherrschaft zunehmend streitig. 1139 hatten die Grafen von Sayn sogar die Grafschaft Bonn belagert.
Baubeginn am Drachenfels
Um 1140 begann Erzbischof Arnold I. von Merxheim (EB 1137-1151) mit dem Bau einer Burg auf dem Drachenfels. Doch seine Männer plünderten in den Dörfern der Umgebung und zerstörten Felder und Weinberge. Besonders schlimm traf es das Bonner St. Cassius-Stift, deshalb bat dessen Propst Gerhard von Are den Erzbischof immer wieder dringend, ihm die Burg zu übertragen, lange Zeit vergeblich.
Doch der Erzbischof war umstritten. Zwar war auch er Reichspolitiker, doch 1148 wurde er wegen lässiger Amtsführung und Simonie vom Papst suspendiert. Seitdem bildete sich im Erzbistum Köln eine Opposition gegen ihn, sie konnte ihn aber nicht stürzen konnte. Doch er geriet in arge Bedrängnis und übertrug schließlich Burg Drachenfels an das Bonner St. Cassiusstift.
Der Kölner Erzbischof bekommt ein weltliches Lehen
Nach Arnolds Tod wurde Arnold II. von Wied Kölner Erzbischof (1151-1157). Ihm verdanken wir die Doppelkirche in Schwarzrheindorf. Er war der Kanzler des ersten Staufers Konrad III.
1151 war es soweit. Im Kölner Dom verlieh König Konrad III. dem Kölner Erzbischof endgültig und in aller Form die rheinische Herzogswürde samt aller zugehörigen weltlichen Rechte und Pflichten, dazu gehörte auch der Bau von Burgen und Befestigungen.
Damals war das Gebiet des kölnischen Herzogtums nicht durch feste Grenzen bestimmt, sondern durch die Anzahl der Adelsfamilien und ihrer Länder, die dem Erzbischof als ihrem Lehnsherrn Gefolgschaft leisteten. Es gab immer wieder Konflikte mit den anderen Regionalfürsten, so 1152, als Arnold II. während einer Fehde mit den Grafen von Sayn deren Stammburg Sayn zerstörte. Wenn ein Erzbischof wie Arnold II. aus der Region kam, ist durchaus denkbar, dass er bei allem nicht nur die Interessen des Kölner Erzbistums, sondern auch die seiner Familie im Auge hatte.
Friedrich I. Barbarossa
1152 kam Konrads Neffe auf den Thron, Friedrich I. Barbarossa, so genannt wegen seines roten Bartes. Für viele war er der Inbegriff eines Königs und Kaisers, denn er war zumeist ritterlich und von seiner hohen Aufgabe erfüllt. Nach den Wirren des Investiturstreits unter den letzten Saliern und dem Scheitern des Zweiten Kreuzzugs wollte er dem Kaisertum neuen Glanz schenken.
Kaiser und Papst
Die streitbaren Päpste des Hochmittelalters sahen das anders: Für sie war der Kaiser der Mond, der seinen Glanz von der Sonne, dem Papsttum erhielt. 80 Jahre zuvor hatte der Salier Heinrich IV. den „Gang nach Canossa“ antreten müssen.
Die veränderten Machtverhältnisse trafen Barbarossa mit voller Wucht. Mehrfach brachte ihn Papst Hadrian IV. zur Weißglut, um seine Kaiserkrone musste er in Rom regelrecht schachern, und dann wiegelte der Papst auch noch die Stadtrömer und die deutsche Geistlichkeit gegen ihn auf. Barbarossa langte es: „Das Reich ist heilig!“ donnerte er. In jenen Jahren entstand in den staufischen Kanzleien der Name „Sacrum Imperium“, Heiliges Reich.
Staufer und Welfen
Barbarossa, Sohn eines Staufers und einer Welfin, sollte Frieden zwischen den Familien stiften. Er versöhnte sich dann auch mit seinem welfischen Vetter Heinrich dem Löwen und übertrug ihm die Herzogtümer Sachsen und Bayern. Seit 1165 war Heinrich zudem Schwiegersohn des englischen Königs Heinrichs II. Plantagenet. Kein anderer Fürst im Reich hat eine solche Machtfülle. Dafür hielt der Löwe dem Kaiser den Rücken frei.
Auf dem nächsten Italienzug im Oktober 1167 war Rainald dabei, an seiner Seite Philipp von Heinsberg, beide kämpften im kaiserlichen Heer. Vor Rom brach im kaiserlichen Lager eine verheerende Seuche aus, und Erzbischof Rainald erlag ihr im August 1167.
Kanzler und Erzbischof Rainald von Dassel
Ganz Barbarossas Mann war Rainald von Dassel (1159-67), Erzbischof von Köln. Er hatte seinen Aufstieg allein dem Kaiser zu verdanken, und hatte vorher keinerlei Verbindung zur Region oder zum Erzbistum. Rainald war in erster Linie des Reiches Kanzler, ein politischer Kopf und sicher eher ein Falke als eine Taube.
Barbarossas Italienzüge
Während am Drachenfels gebaut wurde, zog Kaiser Friedrich Barbarossa immer wieder mit einer großen Armee über die Alpen gegen die oberitalienische Städte.
Oberitalien gehörte seit den Tagen Ottos des Großen zum Reich, und die lombardischen Städte waren reich. Doch inzwischen hatten die deutschen Herrscher im Kampf mit dem Papsttum viel Ansehen und Einfluss verloren. Die aufblühenden Städte hatten den Freiraum für sich genutzt, prägten ihre eigenen Münzen, forderten Zölle und Steuern nach eigenem Ermessen und für ihre Kassen, und Selbstverwaltung. Was Barbarossa für die Rechte des Reiches hielt, empfanden sie als Unrecht. Sie hatten sich alles selbst erarbeitet, durch Fleiß und Unternehmergeist, und nun kam der Kaiser von jenseits der Alpen mit seinem Heer über sie.
Der Kampf wurde auf beiden Seiten unerbittlich, ja grausam geführt. Barbarossa ließ sogar 1162 Mailand zerstören. Die wertvollen Mailänder Reliquien verteilte er an seine Bischöfe, die kostbarsten, die Gebeine der Heiligen Drei Könige, brachte Kanzler Rainald von Dassel 1164 als Kriegsbeute nach Köln.
Nach dem Tod Papst Hadrians IV. kam es zu einer Doppelwahl. Barbarossas Favorit Viktor IV. fand kaum Anerkennung in Europa, dafür umso mehr Gegenpapst Alexander III. Der bannte den Kaiser.
Damals im Siebengebirge
Burg Drachenfels steht
Propst Gerhard von Are in Bonn wird einige dankbare Gedanken zu Barbarossas Papst Viktor nach Rom geschickt haben, denn am 11. September 1162 bestätigte der ihm den Erwerb des Drachenfelses. 1167 war die Burg fertiggestellt. Es war eine Gipfelburg, gut geschützt durch ihre Lage. Angreifer konnten kaum schweres Belagerungsgerät herauf bringen; zudem waren sie Brandpfeilen, Steinen und Pechnasen ausgesetzt.
Die Verwaltung von Burg Drachenfels übertrug das St. Cassius-Stift Dienstleuten, den Ministerialen. Diese Personengruppe treffen wir seit Barbarossas Zeit im Stauferreich an, sie übernahmen Verwaltungsaufgaben und leisteten ebenso Kriegsdienst. Auf dem Drachenfels ist als erster Godart genannt, der Zusatz „vom Drachenfels“ bezeichnet den Dienstort.
 Mehr über Burg Drachenfels und die Drachenfelser Burggrafen Sie im Kapitel Burgruinen:
Mehr über Burg Drachenfels und die Drachenfelser Burggrafen Sie im Kapitel Burgruinen:
Burg Drachenfels
Die Herren vom Siebengebirge – Hochmittelalter
Die Grafen von Sayn
In der zweiten Generation hatten die Grafen von Sayn aus dem Westerwald im Bonner Raum und an der Sieg viel Einfluss gewonnen. Graf Heinrich II. hatte Agnes von Saffenberg geheiratet, die Tochter einer bedeutende Familie am Niederrhein. Er bekam wichtige Bonner Vogteien übertragen und wurde nach dem Tod seines Schwiegervaters 1174 Kölner Domvogt. Noch war keine Rede von der Burg auf der Löwenburg im Siebengebirge, doch mit der Saffenberger Heirat kam auch das Löwenburger Land an die Familie.
Heinrich II. und Eberhard II. standen im Reichsdienst und begleiteten Kaiser Barbarossa auf seinen Italienzügen. Das Siegel der Grafen zeigt zwei Ritter auf einem Pferd, sie müssen einander nahegestanden haben. Der jüngere Bruder Bruno wurde 1192 Propst des Bonner St. Cassius-Stiftungs.
Oberhalb der Sieg entstand ihre Burg Blankenberg. Das brachte ihnen freilich erheblichen Ärger mit den Äbten von Siegburg und deren Vögten, den Grafen von Berg. Erzbischof Philipp von Heinsberg vermittelte; 1181 war Burg Blankenberg fertiggestellt.
Die Grafen von Berg
Die Berger waren eine mächtige Familie im Norden unserer Region. Sie hatten bereits zwei Kölner Erzbischöfe gestellt und strebten auch weiter dieses Amt an. In den 1160er Jahren hatten sie sich in eine rheinische und eine westfälische Linie, die von Altena, geteilt. Als der amtierende Graf Engelbert I., gut bekannt mit Kaiser Barbarossa, 1174 Burg Windeck als Lehen erhielt, konnten die Berger an der mittleren Sieg Fuß fassen. Zudem hatte er einen Feste gegen seine Konkurrenten, die Grafen von Sayn. Als Siegburger Vögte unterstand ihnen auch die Siegburger Propstei in Oberpleis.
Erzbischof Philipp von Heinsberg
Auf dem Italienzug im Oktober 1167 war Rainald dabei, an seiner Seite Philipp von Heinsberg, beide kämpften im kaiserlichen Heer. Vor Rom brach im kaiserlichen Lager eine verheerende Seuche aus, und Erzbischof Rainald erlag ihr im August 1167. Nun trat sein Vertrauter und Mitstreiter Philipp von Heinsberg die Nachfolge an.
Als einer der mächtigsten Männer im Reich war er regelmäßig am kaiserlichen Hof. Er krönte Friedrichs erst vierjährigen Sohn Heinrich in Aachen und nahm an Barbarossas fünften Italienzug (1174-1178) teil. Der Kaiser betraute ihn mit wichtigen Missionen.
Anders als sein Vorgänger Rainald stammte Philipp aus rheinischem Adel. Sein Episkopat ist geprägt von dem Bestreben, seinen Einfluss auf die Adligen in der Region zu stärken und seinen Machtbereich auszudehnen. Wo der Erzbischof aber seine Macht ausdehnt, muss ein anderer zurückweichen. Dann nahm Philipp Westfalen ins Visier, und das gehörte einem mächtigen Nachbarn, nämlich Heinrich dem Löwen, dem mächtigen Herzog von Sachsen und Bayern aus der Familie der Welfen.
Der Sturz Heinrichs des Löwen
Heinrich der Löwe war der nach dem Kaiser mächtigste Mann in Deutschland, und so trat er auch auf. Das schürte Unmut und Neid bei den anderen Fürsten. Als Barbarossa 1176 erneut gegen die oberitalienischen Städte gezogen war, hatte ihm der Löwe die Gefolgschaft verweigert. Der Kaiser hatte eine schwere Niederlage erlitten, Frieden schließen und den ihm verhassten Alexander III. als Papst anerkennen müssen.
Doch Heinrich der Löwe hatte den Bogen überspannt. Über ihn wurde die Reichsacht verhängt, Kaiser und Fürsten gingen mit Waffengewalt gegen ihn vor, allen voran der Kölner Erzbischof Philipp von Heinsberg. Schließlich verlor er all seinen Besitz bis auf Braunschweig und Lübeck, und wurde für drei Jahre verbannt. Er ging mit seiner Familie an den Hof seines englischen Schwiegervaters Heinrich II.
Die zweite Herzogswürde für den Erzbischof
Am meisten profitierte der Kölner Erzbischof vom Sturz Heinrichs des Löwen. Mit der Gelnhäuser Urkundevom 13. April 1180 bekam er Westfalen als zweites Herzogtum übertragen. Nun war er der mächtigste Mann nach dem Kaiser.
In der Region gelang es Erzbischof Philipp, sein Territorium gezielt auszubauen und zu festigen. Für sehr viel Geld kaufte er Burgen, Gehöfte und befestigten Plätzen, und erwarb er auch die zugehörigen Rechtstitel. Eigener Besitz bedeutete eigene Macht, und damit eine ungleich stärkere Stellung als ein Lehnsmann sie hatte.
„Vom Kölner Pfaffen gezwungen ..“ der Erzbischof überzieht
Der Kölner Erzbischof Philipp von Heinsberg hatte eine Machtfülle, die den Kaiser und die anderen Fürsten beunruhigte. Der bemühte sich nun darum, die Fürsten von Luxemburg, Namur und Hennegau im Westen des Reiches auf seine Seite zu ziehen.
Vieles kam zusammen. Der Kaiser verübelte dem Erzbischof, dass er ihn wegen Heinrich dem Löwen so unter Druck gesetzt hatte, ihm praktisch sein Vorgehen diktiert hatte. Die Missstimmung konnte man greifen. Fast hätte der Erzbischof wegen eines Rangstreits schon das Mainzer Hoffest 1184 unter Protest verlassen. Dann wandte sich Friedrich Barbarossa weg von dem Bündnis mit England und hin zu König Philipp II. August von Frankreich. Dem Erzbischof und seiner Stadt Köln hingegen lag an guten und profitbringenden Handelsbeziehungen zu England.
Als Philipp im März 1187 nach Köln einlud, folgten 4.000 Ritter dem Ruf. Aus Sicht des Kaisers machte der Erzbischof mobil, deshalb zog er im Juni 1187 mit einem Heer gegen Köln. Verhandlungen scheiterten. Schließlich erklärte Barbarossa am Weihnachtstag 1187 von Trier aus, „er werde in seinem vorgerückten Alter vom Kölner Pfaffen gezwungen, ein Heer zu sammeln und gegen seinen Willen einen Teil des Reichs zu verwüsten“. Wir wissen nicht, ob es wirklich dazu kam, hoffentlich nicht. Letztendlich behielt der Kaiser die Oberhand, Erzbischof Philipp unterwarf sich im März 1188.
Als vornehme Lehnsleute Erzbischof Philipps von Heinsberg leisteten die Grafen von Sayn Heeresfolge. Sie waren bei den Feldzügen gegen Heinrich den Löwen dabei, die den Löwen stürzten und den Erzbischof zum mächtigsten Mann nach dem Kaiser machten. Sie haben wohl hautnah mitbekommen, wie sich das Verhältnis zwischen Kaiser Barbarossa und Erzbischof Philipp immer weiter verschlechterte, bis der Kaiser schließlich gegen den Erzbischof zog. Der Erzbischof musste zunächst einlenken, auf den Hoftagen vertraten die Grafen seine Interessen.
Damals im Siebengebirge
Erzbischof Philipp und der Petersberg
In der Region hielt der Erzbischof weiter Augen und Ohren offen. Vor Jahrzehnten hatten Augustiner-Mönche auf dem Petersberg gelebt und eine kleine Kirche gebaut, doch inzwischen waren sie weggezogen. Erzbischof Philipp hatte sich vorsichtshalber alle Rechte an dem Berg gesichert.
Im März 1189 rief er Zisterzienser aus Himmerod ins Siebengebirge. Am 22. März kamen zwölf Mönche unter ihrem Abt Hermann über die Mosel und den Rhein auf den Stromberg. Sie bezogen die verlassenen Gebäude, bauten die Kirche aus und widmeten sie dem Heiligen Petrus, seitdem hieß der Berg Petersberg.
Auch das hat eine politische Seite. Nun, da sich Zisterziensermönche auf dem Petersberg ansiedelten, konnte kein anderer dort seine Burg bauen.
Barbarossa und die Kölner Erzbischöfe | Zum Weiterlesen
Philipp von Heinsberg im Portal Rheinische Geschichte
Stauferzeit
Friedrich Barbarossa und die Kölner Erzbischöfe | Herrscher, Minnesänger und Zisterzienser | Krieg um den Thron | Europa im Umbruch | Friedrich II. und die Herren vom Siebengebirge | Der ferne Kaiser

Hinterlasse jetzt einen Kommentar